Produktivitäten
Die wichtigsten Punkte im Überblick
In der heutigen Geschäftswelt entscheidet die Produktivität maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen. Während 53% der führenden Unternehmen ihre Produktivitätskennzahlen regelmäßig überwachen, kämpfen viele Organisationen noch immer damit, ihre Ressourcen optimal zu nutzen. Die Fähigkeit, das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis zu verstehen und zu optimieren, wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Doch Produktivität spielt nicht nur in Unternehmen, sondern auch im Alltag eine wichtige Rolle, da sie unsere täglichen Routinen und Handlungen beeinflusst.
Produktivität ist weit mehr als nur eine einfache Kennzahl - sie bildet das Fundament für nachhaltiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Der Begriff Produktivität bezeichnet im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen Input und Output beschreibt und sich von verwandten Begriffen wie Wirtschaftlichkeit und Rentabilität unterscheidet. Von der Arbeitsproduktivität einzelner Mitarbeiter bis hin zur totalen Faktorproduktivität ganzer Volkswirtschaften: Das Verständnis verschiedener Produktivitäten und ihrer Messung ermöglicht es Führungskräften, gezielte Verbesserungen zu implementieren.
In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie alles Wichtige über Produktivität: von den grundlegenden Definitionen und Berechnungsformeln über die verschiedenen Arten bis hin zu bewährten Strategien zur Produktivitätssteigerung. Wir zeigen Ihnen praxisnahe Beispiele und geben Ihnen das Rüstzeug an die Hand, um Produktivität in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu messen und zu optimieren.
Was ist Produktivität? - Definition und Grundlagen
Produktivität bezeichnet eine zentrale betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem erzielten Produktionsergebnis (Output) und den eingesetzten Produktionsfaktoren (Input) beschreibt. Bei der Produktivitätsmessung spielt die Arbeitszeit als Ressource eine wichtige Rolle, da sie direkt mit der Arbeitsproduktivität und der Effizienz der Arbeitsleistung verknüpft ist. Diese Definition aus der Betriebswirtschaftslehre bildet die Grundlage für das Verständnis wirtschaftlicher Effizienz in Unternehmen und der Volkswirtschaftslehre.
Die Produktivität misst, wie effizient ein Unternehmen, ein Team oder eine Person eingesetzte Ressourcen in Ergebnisse oder Produkte umsetzt. Arbeit ist dabei einer der wichtigsten Produktionsfaktoren, dessen Optimierung – etwa durch Schulungen, Anpassung der Arbeitszeit oder technologische Verbesserungen – die Produktivität maßgeblich steigern kann. Der Ausstoß, also die produzierte Menge an Gütern oder Dienstleistungen, wird durch den gezielten Einsatz verschiedener Produktionsfaktoren beeinflusst. Die betriebswirtschaftliche Sicht auf die Produktivität umfasst die Analyse und Optimierung betriebsinterner Abläufe, wobei Daten zur Erhebung und Auswertung von Leistungskennzahlen eine zentrale Rolle spielen. Die Einsatzmengen der Produktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital oder Boden bestimmen maßgeblich die Produktivität, da sie den Input für den Produktionsprozess liefern. Die Rolle des Faktors Arbeit, Kapital oder Boden wird bei der Produktivitätsmessung durch das Verhältnis von Output zu Input-Menge deutlich. Die Menge der eingesetzten Ressourcen und die produzierte Output-Menge sind entscheidend für die Berechnung und Bewertung der Produktivität. Der Produktionsvorgang beschreibt dabei die Umwandlung von Input in Output und steht im Zentrum der Produktivitätsanalyse. Verschiedene betriebswirtschaftliche Sichten und Perspektiven ermöglichen eine differenzierte Betrachtung der Produktivität und ihrer Einflussfaktoren. Der Vergleich von Produktivitätskennzahlen dient dem Benchmarking und der Identifikation von Optimierungspotenzialen.
Ein entscheidender Unterschied liegt in der Abgrenzung zur Wirtschaftlichkeit: Während Produktivität das Mengenverhältnis zwischen Input und Output fokussiert, bezieht sich Wirtschaftlichkeit auf das Wertverhältnis von Ertrag zu Kosten. Diese Unterscheidung ist in der Praxis von großer Bedeutung, da sie verschiedene Perspektiven der Unternehmensanalyse ermöglicht.
Produktivität ist sowohl im produzierenden Gewerbe als auch bei Dienstleistungen relevant. Sie dient als Grundlage, um Prozesse und Ressourcennutzung zu bewerten, Engpässe zu identifizieren und gezielte Optimierungen vorzunehmen. In allen Bereichen der Wirtschaft ermöglicht die Produktivitätsmessung eine objektive Bewertung der Leistungsfähigkeit. In der Volkswirtschaft beschreibt die Produktivität die Leistungsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften und ist ein zentrales Kriterium für die Analyse nationaler Wirtschaftssysteme. Die Produktivität ist somit ein wesentlicher Faktor für die volkswirtschaftliche Entwicklung und das Wirtschaftswachstum.
Produktivität berechnen: Formeln und Beispiele
Die Berechnung der Produktivität folgt einer klaren, standardisierten Formel, die in verschiedenen Kontexten angewendet werden kann. Die Aussagekraft von Produktivitätskennzahlen liegt darin, dass sie für Vergleiche und Analysen zwischen Unternehmen oder Zeiträumen herangezogen werden können. Der Kapitaleinsatz stellt dabei eine wichtige Inputgröße dar, die bei der Produktivitätsberechnung berücksichtigt wird. Lässt sich die Produktivität durch verschiedene Methoden und Kennzahlen messen, können gezielt Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Der Arbeitseinsatz, gemessen als Menge an geleisteten Arbeitsstunden, ist ein zentraler Faktor im Produktionsprozess zur Messung der Produktivität. Die Größe der Input- und Outputmengen ist eine wesentliche Messgröße bei der Bewertung der Produktivität. Güter, also die produzierten Waren oder Dienstleistungen, stellen den Output dar, der in Relation zu den eingesetzten Ressourcen bewertet wird. Die Maschinenproduktivität dient als Kennzahl, um die Effizienz von Maschinen im Produktionsprozess zu bestimmen.
Die Grundformel lautet:
Produktivität = Ausbringungsmenge (Output) / Einsatzmenge (Input)
Diese Formel bildet das Fundament für alle weiteren Produktivitätsanalysen und ermöglicht eine quantifizierbare Bewertung der Effizienz.
Praktisches Beispiel aus der Produktion
Ein konkretes Beispiel verdeutlicht die Anwendung: Werden in einer Woche 56.000 Metallteile mit einem Ressourceneinsatz von 10.000 Arbeitsstunden gefertigt, beträgt die Arbeitsproduktivität 5,6 Stück pro Arbeitsstunde. Der Ausstoß, also die produzierte Menge an Metallteilen, liegt in diesem Fall bei 56.000 Stück. Die Einsatzmengen, wie hier die 10.000 Arbeitsstunden, stellen die Inputgröße im Produktionsprozess dar. Die Output-Menge von 56.000 Metallteilen dient als Kennzahl, um die Produktivität und Effizienz der eingesetzten Ressourcen zu messen. Diese Kennzahl ermöglicht sowohl Vergleiche zwischen verschiedenen Produktionslinien als auch die Bewertung von Verbesserungsmaßnahmen.
Herausforderungen bei der Messung
Bei der praktischen Anwendung ergeben sich verschiedene Herausforderungen. Unterschiedliche Outputs, wie beispielsweise Schrauben versus komplexe Maschinen, müssen zur Vergleichbarkeit mit Marktpreisen oder Herstellkosten gewichtet werden. Für eine fundierte Analyse und Vergleichbarkeit der Produktivität ist die Erhebung und Auswertung relevanter Daten, wie Unternehmenskennzahlen oder Leistungsdaten, unerlässlich. Input und Output lassen sich sowohl als Stromgrößen (pro Zeiteinheit) als auch als Bestandsgrößen messen.
Besonders bei längerfristigen Vergleichen wird eine Preisbereinigung notwendig, um Inflationseffekte auszuschließen und aussagekräftige Produktivitätsvergleiche zu ermöglichen. In der Software-Entwicklung kommen spezialisierte Methoden wie NESMA Funktionspunkte oder COSMIC zum Einsatz, um standardisierte Produktivitätsmetriken zu schaffen.

Arten der Produktivität
Die verschiedenen Arten der Produktivität ermöglichen differenzierte Analysen und spezifische Optimierungsansätze, wobei die Rolle des jeweiligen Faktors bei der Produktivitätsmessung besonders im Fokus steht. Je nach Betrachtungsweise und Zielsetzung kommen unterschiedliche Messverfahren zum Einsatz.
Partielle Faktorproduktivität
Die partielle Faktorproduktivität misst das Verhältnis des Outputs zu einem einzelnen eingesetzten Produktionsfaktor. Diese Art der Messung ermöglicht gezielte Analysen einzelner Ressourcen und deren Effizienz.
Arbeitsproduktivität stellt die bekannteste und wichtigste Form dar. Sie misst den Output pro Arbeitseinheit und wird häufig als Bruttoinlandsprodukt pro geleistete Arbeitsstunde ausgedrückt. In Unternehmen zeigt sich die Arbeitsproduktivität beispielsweise in der Anzahl bearbeiteter Kundenanfragen pro Mitarbeiter oder produzierten Stückzahlen pro Arbeitsstunde.
Kapitalproduktivität erfasst den Output pro eingesetzte Kapitaleinheit, gemessen in Maschinenstunden oder investiertem Kapital. Bei der Messung der Kapitalproduktivität wird der Kapitaleinsatz als Inputgröße betrachtet, um die Effizienz des eingesetzten Kapitals im Verhältnis zum erzielten Output zu bewerten. Diese Kennzahl ist besonders relevant für Investitionsentscheidungen und die Bewertung des Kapitaleinsatzes.
Materialproduktivität beschreibt das Verhältnis von Output zu Materialverbrauch und ist in der Industrie entscheidend für die Ressourceneffizienz. Eine hohe Materialproduktivität bedeutet weniger Verschwendung und geringere Produktionskosten.
Bodenproduktivität findet insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft Anwendung und misst den Ertrag pro Hektar. Diese spezielle Art der Produktivitätsmessung berücksichtigt die Besonderheiten natürlicher Ressourcen.
Totale Faktorproduktivität (TFP)
Die totale Faktorproduktivität betrachtet das Zusammenwirken aller Produktionsfaktoren gleichzeitig. Die Formel lautet:
TFP = Output / Summe aller Input-Faktoren
Dabei werden die Einsatzmengen der verschiedenen Produktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital und Boden berücksichtigt, um die Produktivität des gesamten Produktionsprozesses zu messen.
Diese umfassende Betrachtung ist ein Schlüsselindikator für technischen Fortschritt, Innovationen und Organisationsverbesserungen. Die Total Factor Productivity erklärt den Anstieg der Outputmenge, der nicht durch die reine Erhöhung einzelner Inputs erklärbar ist. In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird sie als technologischer Fortschritt oder als der unerklärbare Rest im Outputwachstum interpretiert.
Grenzproduktivität
Die Grenzproduktivität bezeichnet den zusätzlichen Output, der durch den Einsatz einer weiteren Einheit eines Produktionsfaktors entsteht, während alle anderen Inputs konstant bleiben. Die Größe der Outputveränderung bei Variation des Inputfaktors dient dabei als Maß für die Grenzproduktivität. Sie ist mathematisch als partielle Ableitung der Produktionsfunktion bestimmbar und ist unter realen Bedingungen meist abnehmend nach dem Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag.
Grenzproduktivitäten bestimmen in vollständigen Wettbewerbsmodellen die Faktorpreise und sind daher von großer theoretischer und praktischer Bedeutung für Unternehmen und Märkte.
Produktivität vs. verwandte Begriffe
Das Verständnis der Unterschiede zwischen Produktivität und verwandten Begriffen ist essentiell für eine präzise Unternehmensanalyse und zielgerichtete Optimierungsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu steht das Gegenteil von Produktivität, nämlich Unproduktivität, die durch ineffiziente oder destruktive Maßnahmen gekennzeichnet ist und die Zielerreichung im Unternehmen behindert.
Produktivität vs. Effizienz
Während Produktivität das Mengenverhältnis von Output zu Input abbildet, steht Effizienz für die Fähigkeit, einen Output mit möglichst geringem Input zu erreichen. Effizienz kann sowohl maximalen Output bei festem Input als auch minimalen Input bei festem Output bedeuten.
Je nach Sicht kann die Analyse von Produktivität und Effizienz unterschiedliche Schwerpunkte setzen, etwa im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Zielsetzungen oder Vergleichbarkeit.
Der zentrale Unterschied liegt im Fokus: Produktivität zielt auf mehr Output bei gleichbleibendem Input, während Effizienz gleichen Output bei reduziertem Input anstrebt. Beide Konzepte zielen auf optimalen Ressourceneinsatz, jedoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Produktivität vs. Wirtschaftlichkeit vs. Rentabilität
Diese drei Begriffe unterscheiden sich fundamental in ihrer Betrachtungsweise:
- Produktivität: Mengenverhältnis Output/Input
- Wirtschaftlichkeit: Wertverhältnis Ertrag/Kosten
- Rentabilität: Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital
Ein Vergleich dieser Kennzahlen ist für die betriebswirtschaftliche Analyse unerlässlich, da er ermöglicht, die Leistung und Effizienz verschiedener Unternehmen, Abteilungen oder Standorte systematisch zu bewerten und Optimierungspotenziale zu identifizieren.
Während Produktivität ausschließlich Mengen betrachtet, bezieht Wirtschaftlichkeit finanzielle Aspekte mit ein. Rentabilität stellt schließlich den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital und ist damit eine Kennzahl für die Kapitalrendite.
Produktivität messen im Unternehmen
Die praktische Messung von Produktivität in Unternehmen erfordert einen systematischen Ansatz und die Auswahl geeigneter Kennzahlen. Verschiedene Indikatoren ermöglichen eine spezifische Bewertung von Abteilungen, Prozessen und Mitarbeitern.
Auswahl relevanter Kennzahlen
Typische Produktivitätskennzahlen umfassen:
- Umsatz pro Mitarbeiter (häufig für Kosten-Nutzen-Betrachtungen genutzt)
- Stückzahl pro Arbeitsstunde (klassische Produktionskennzahl)
- Durchsatz pro Ressourceneinheit
- Anzahl bearbeiteter Vorgänge pro Zeiteinheit (vor allem in Dienstleistung und Verwaltung)
- Durchlaufzeit, Ausschussquote, Reklamationsrate als ergänzende Größen zur Qualitätskontrolle
Die Output-Menge ist dabei eine zentrale Kennzahl, um die Effizienz einzelner Produktionsfaktoren zu bewerten und das Verhältnis von produziertem Output zur eingesetzten Input-Menge zu bestimmen.
Übersicht der Messverfahren
Da eine Gesamtproduktivität schwer bestimmbar ist, fokussieren Unternehmen oft auf Teilproduktivitäten. Diese ermöglichen gezielte Verbesserungen in spezifischen Bereichen und schaffen Transparenz über Leistungsunterschiede.
Für Benchmark-Vergleiche und die Bewertung der Produktivität spielen erhobene und ausgewertete Daten eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für fundierte betriebliche Analysen und Vergleiche bilden.
Benchmark-Vergleiche mit Vorperioden oder Branchenwerten sind essentiell für die Bewertung der Leistungsentwicklung. Die Produktivitätsveränderung wird quantifiziert als:
Produktivitätsveränderung = (Produktivität - Produktivität_Benchmark) / Produktivität_Benchmark
Regelmäßige Messung und Trends
Die regelmäßige Messung - monatlich oder quartalsweise - ermöglicht es, Trends und Optimierungsmöglichkeiten frühzeitig zu identifizieren. Die kontinuierliche Erhebung und Auswertung relevanter Daten ist dabei entscheidend, um Produktivitätstrends im Unternehmen zuverlässig zu erkennen. Experten empfehlen, produktivitätsbezogene KPIs in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um saisonale Schwankungen und nachhaltige Trends zu erkennen.
Prozessoptimierung als Hebel für Produktivität
Prozessoptimierung zählt zu den wirkungsvollsten Hebeln, um die Produktivität im Unternehmen nachhaltig zu steigern. Durch eine gezielte Analyse bestehender Prozesse lassen sich Schwachstellen und Ineffizienzen identifizieren, die den optimalen Einsatz von Ressourcen behindern. Unternehmen, die ihre Abläufe regelmäßig überprüfen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung umsetzen, können nicht nur ihre Produktionsergebnisse erhöhen, sondern auch Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Im Zentrum der Prozessoptimierung steht das Ziel, den Ressourceneinsatz zu minimieren und gleichzeitig den Output zu maximieren. Dies gelingt, indem Unternehmen ihre Arbeitsabläufe systematisch hinterfragen, Engpässe beseitigen und innovative Lösungen implementieren. Die kontinuierliche Optimierung von Prozessen ist somit ein entscheidender Faktor, um die Produktivität zu steigern und den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern.
Methoden der Prozessoptimierung
Um die Produktivität und Effizienz im Unternehmen gezielt zu steigern, stehen verschiedene bewährte Methoden der Prozessoptimierung zur Verfügung:
- Lean-Management: Dieser Ansatz fokussiert sich auf die konsequente Beseitigung von Verschwendung in allen Unternehmensbereichen. Durch die Optimierung von Prozessen und die Reduzierung nicht-wertschöpfender Tätigkeiten wird die Produktivität gesteigert und die Effizienz erhöht.
- Six Sigma: Mit Six Sigma steht Unternehmen eine strukturierte Methode zur Verfügung, um Fehlerquellen in Prozessen zu identifizieren und nachhaltig zu beseitigen. Ziel ist es, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern und so die Produktivität zu erhöhen.
- Kaizen: Kaizen setzt auf die kontinuierliche, schrittweise Verbesserung von Prozessen und Produkten. Durch kleine, regelmäßige Veränderungen werden Effizienz und Produktivität im Unternehmen langfristig gesteigert.
- Business-Process-Reengineering: Dieser Ansatz geht einen Schritt weiter und setzt auf die grundlegende Neugestaltung von Prozessen. Unternehmen analysieren ihre Abläufe von Grund auf und entwickeln innovative Lösungen, um die Produktivität und Effizienz signifikant zu verbessern.
Der gezielte Einsatz dieser Methoden ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse optimal aufeinander abzustimmen, Ressourcen effizient zu nutzen und die Produktivität nachhaltig zu steigern.
Praxisbeispiele und Erfolgsfaktoren
Zahlreiche Unternehmen haben durch gezielte Prozessoptimierung ihre Produktivität und Effizienz deutlich gesteigert. So hat beispielsweise Toyota mit der Einführung von Lean-Management und Kaizen seine Produktionsprozesse revolutioniert und weltweit Maßstäbe in Sachen Produktivität gesetzt. General Electric konnte durch die Implementierung von Six Sigma die Fehlerquote in der Produktion drastisch senken und die Produktivität erhöhen. Dell wiederum hat mit Business-Process-Reengineering seine Abläufe neu gestaltet und dadurch die Produktivität im gesamten Unternehmen gesteigert.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Prozessoptimierung sind:
- Klare Vision und Strategie: Unternehmen benötigen eine eindeutige Zielsetzung und eine durchdachte Strategie, um alle Beteiligten auf das gemeinsame Ziel der Produktivitätssteigerung auszurichten.
- Umfassende Analyse der Prozesse: Nur durch eine detaillierte Analyse lassen sich Schwachstellen und Potenziale zur Effizienzsteigerung erkennen.
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung: Prozesse müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um dauerhaft produktiv und effizient zu bleiben.
- Gute Kommunikation und Zusammenarbeit: Eine offene Kommunikation und enge Kooperation zwischen allen Abteilungen und Teams ist entscheidend, damit Optimierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können.
Durch die konsequente Anwendung dieser Erfolgsfaktoren können Unternehmen ihre Produktivität gezielt steigern und sich im Wettbewerb nachhaltig behaupten.
Produktivität steigern: Strategien und Maßnahmen
Die Steigerung der Produktivität erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Faktoren und Prinzipien berücksichtigt. Erfolgreiche Optimierung basiert auf systematischen Strategien und gezielten Maßnahmen.
Ökonomische Prinzipien
Drei grundlegende Prinzipien leiten Produktivitätssteigerungen:
Das Minimalprinzip zielt darauf ab, einen fest definierten Output mit minimalem Ressourceneinsatz zu erreichen. Dieses Prinzip eignet sich besonders für Unternehmen mit festgelegten Produktionszielen. Durch die Anwendung des Minimalprinzips lässt sich die Produktivität gezielt steigern, indem unnötige Aufwände vermieden werden.
Beim Maximalprinzip wird mit gegebenem Input der Output maximiert. Diese Herangehensweise bietet sich an, wenn Ressourcen begrenzt, aber die Nachfrage hoch ist.
Das Extremumprinzip kombiniert beide Ansätze und hilft, Zielkonflikte zu lösen. Es ermöglicht flexible Optimierung je nach Marktlage und Unternehmenssituation.
Faktoren der Mitarbeiterproduktivität
Die Produktivität von Mitarbeitern wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die systematisch optimiert werden können:
Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen umfassen die Gestaltung von Arbeitsplätzen hinsichtlich Licht, Lärm und Ergonomie. Studien zeigen, dass optimierte Arbeitsumgebungen die individuelle Leistung um bis zu 15% steigern können.
Motivation und Employee Experience werden durch Anreizsysteme, flexible Arbeitszeiten und eine positive Unternehmenskultur gefördert. Laut Studien aus der Praxis führen Maßnahmen wie Homeoffice-Angebote oder flexible Arbeitszeiten zu Produktivitätssteigerungen von bis zu 13% im internationalen Durchschnitt.
Ein zentraler Aspekt ist die effiziente Nutzung der Arbeitszeit, da eine gezielte Erfassung und Optimierung der Arbeitszeit maßgeblich zur Steigerung der Arbeitsproduktivität beiträgt.
Qualifikation und Weiterbildung stärken die Kompetenz der Mitarbeiter durch kontinuierliche Schulungen und Entwicklungsprogramme. Investitionen in Wissen und Fähigkeiten zahlen sich langfristig durch höhere Arbeitsleistung aus.
Moderne Technologien und Tools unterstützen effizientes Arbeiten durch Automatisierung und digitale Workflows. Investitionen in Automatisierungstechnologien können in der Industrie, je nach Ausgangslage, Effizienzgewinne von bis zu 30% bringen.
Ziele definieren und KPIs festlegen
Erfolgreiche Produktivitätssteigerung beginnt mit klaren Zielsetzungen und messbaren Kennzahlen:
- Zeit bis zur ersten Antwort und Bearbeitungszeit
- Anzahl bearbeiteter Vorgänge pro Zeiteinheit
- Kundenzufriedenheitswerte (CSAT) als Qualitätsindikator
- Regelmäßige Leistungsmessung gemeinsam mit Mitarbeitenden
Die Erhebung und Auswertung relevanter Daten ist dabei entscheidend, um KPIs festzulegen und deren Entwicklung zur Produktivitätssteigerung kontinuierlich zu überwachen.
Diese KPIs ermöglichen eine objektive Bewertung von Verbesserungsmaßnahmen und schaffen Transparenz über den Fortschritt.
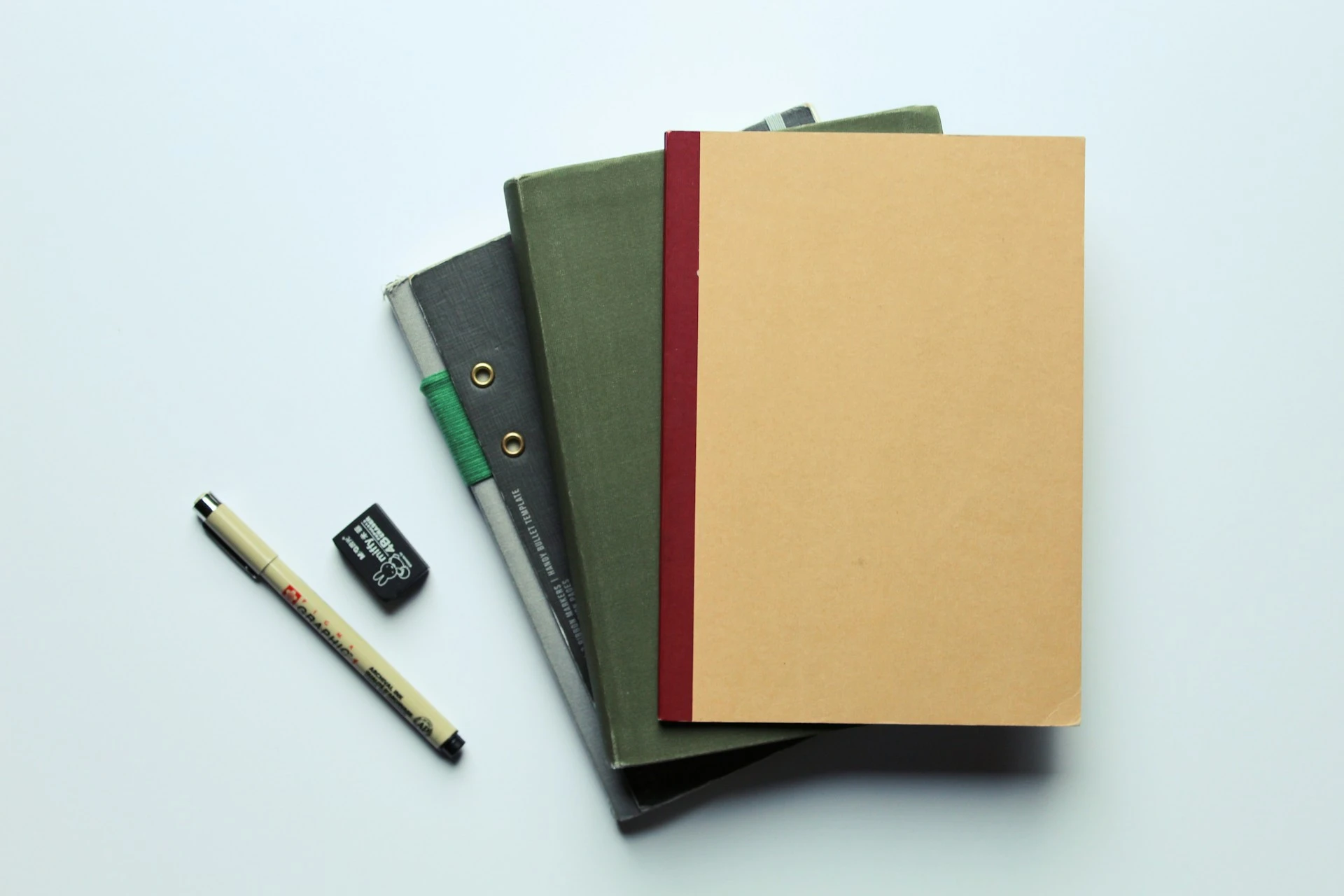
Volkswirtschaftliche Bedeutung der Produktivität
Produktivität spielt eine zentrale Rolle für den wirtschaftlichen Wohlstand und die Entwicklung von Ländern und Regionen, insbesondere im Rahmen der Volkswirtschaft und für das Wachstum ganzer Volkswirtschaften. Die verschiedenen Aspekte der volkswirtschaftlichen Produktivität beeinflussen sowohl einzelne Unternehmen als auch ganze Volkswirtschaften. Die Größe einer Volkswirtschaft ist dabei ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Produktivität, da sie das Ausmaß der eingesetzten Produktionsfaktoren und den Umfang des Outputs bestimmt. Die produzierten Güter stellen den Output der Volkswirtschaft dar und dienen als Maßstab für die Effizienz und Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Einsatz von Ressourcen.
Arbeitsproduktivität als Wohlstandsindikator
Die Arbeitsproduktivität wird als reales BIP pro Arbeitsstunde oder je Erwerbstätigem gemessen und gilt als Schlüsselindikator für den Wohlstand eines Landes. Laut OECD stieg die Arbeitsproduktivität in Deutschland von den 1990er Jahren bis Mitte der 2010er um circa 1,5% jährlich, schwächte sich zuletzt jedoch ab.
Diese Entwicklung spiegelt sich in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wider und beeinflusst die Lebensstandards der Bevölkerung direkt. Länder mit höherer Arbeitsproduktivität können in der Regel höhere Löhne zahlen und bessere soziale Leistungen anbieten.
Kapitalproduktivität und Investitionseffizienz
Sinkende Kapitalproduktivität, ausgelöst etwa durch Überinvestitionen oder ineffiziente Kapitalverwendung, kann die Rendite von Unternehmen oder ganzen Volkswirtschaften gefährden. Der Kapitaleinsatz ist dabei ein entscheidender Faktor für die Bewertung der Kapitalproduktivität in Volkswirtschaften. Dies führt zu Ressourcenumverteilungen und beeinflusst Investitionsentscheidungen maßgeblich.
Standortfaktoren und regionale Entwicklung
Verschiedene Faktoren beeinflussen die Produktivitätsentwicklung von Standorten:
- Infrastruktur und Verkehrsanbindung
- Bildungsniveau und Qualifikation der Arbeitskräfte
- Innovationskraft und Forschungsaktivitäten
- Regulatorische Rahmenbedingungen
- Die Größe eines Standorts, etwa gemessen an der verfügbaren Bodenfläche oder der Produktionsgröße, wirkt sich ebenfalls auf die Produktivitätsentwicklung aus.
Diese Standortfaktoren bestimmen die Attraktivität für Unternehmen und beeinflussen langfristige Wirtschaftsentwicklungen.
Technischer Fortschritt und TFP
TFP-Zuwächse durch Digitalisierung, Automatisierung oder Organisationsinnovationen gelten als wichtigste Treiber nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Ein Beispiel für technische Effizienzsteigerungen im Zuge des technischen Fortschritts ist die Verbesserung der Maschinenproduktivität, also das Verhältnis von Maschinenstunden zur produzierten Menge. Laut World Economic Forum sind bis zu 50% des Wirtschaftswachstums der Industrieländer in den letzten 50 Jahren auf TFP-Steigerungen zurückzuführen.
Praktische Umsetzung im Unternehmen
Die erfolgreiche Implementierung von Produktivitätsverbesserungen erfordert einen strukturierten Ansatz, der verschiedene Bereiche des Unternehmens umfasst.
Schulungen und Entwicklung
Qualifizierungsmaßnahmen bilden das Fundament für nachhaltige Produktivitätssteigerungen:
Gezielte Schulungen tragen wesentlich dazu bei, den Einsatz von Arbeit zu optimieren und die Produktivität im Unternehmen zu steigern.
Gründliches Onboarding für neue Mitarbeitende schafft von Beginn an die Voraussetzungen für effizientes Arbeiten. Strukturierte Einarbeitungsprogramme reduzieren die Zeit bis zur vollen Produktivität erheblich.
Kontinuierliche Weiterbildung zur Kompetenzstärkung hält das Wissen auf dem neuesten Stand und ermöglicht den Umgang mit neuen Technologien und Prozessen.
Bereitstellung von Lernressourcen und Wissensdatenbanken unterstützt selbstständiges Lernen und schnelle Problemlösung. Digitale Plattformen ermöglichen zeit- und ortsunabhängigen Zugang zu relevanten Informationen.
Technologie und Tools
Der intelligente Einsatz von Technologie multipliziert die Produktivität erheblich:
Software-Lösungen zum Task-Management, zur Automatisierung von Routinetätigkeiten und für Analyse- und Controlling-Tools erhöhen die Skalierbarkeit und Effizienz erheblich. Die gezielte Erhebung und Auswertung von Daten spielt dabei eine zentrale Rolle, um die passenden Technologien auszuwählen und deren Nutzen für die Produktivitätssteigerung messbar zu machen.
Automatisierung durch Robotic Process Automation und digitale Workflows kann laufende Prozesse entlasten und Kapazitäten freisetzen. In hochdigitalisierten Unternehmen liegt die durchschnittliche Produktivität regelmäßig 15-25% über dem Wert vergleichbarer Unternehmen ohne Digitalisierung.
Integration verschiedener Systeme für effiziente Workflows eliminiert Medienbrüche und reduziert manuelle Übertragungsfehler. Moderne ERP-Systeme verbinden alle Unternehmensbereiche und schaffen durchgängige Datenflüsse.
Messung und Kontrolle
Kontinuierliches Monitoring und Anpassung sichern den Erfolg von Produktivitätsmaßnahmen:
Die kontinuierliche Erhebung und Auswertung relevanter Daten ist entscheidend, um die Kontrolle und Steuerung von Produktivitätsmaßnahmen zu gewährleisten. Die Messung von Zeit bis zur ersten Reaktion (first response time), Durchlaufzeiten je Prozessschritt und regelmäßige Leistungsmessungen im Dialog mit Mitarbeitenden helfen, Verbesserungspotenziale frühzeitig zu identifizieren.
Qualität des Outputs muss parallel zur Mengenproduktivität überwacht werden. Sinkende Qualität kann zu vermeintlichen Produktivitätssteigerungen führen, die in der Praxis aber zu Nacharbeit und erhöhten Fehlerquoten führen.
FAQ - Häufig gestellte Fragen zur Produktivität
Wie unterscheidet sich Produktivität von Leistung? Produktivität misst das Verhältnis von Output zu Input, während Leistung lediglich das absolute Ergebnis beschreibt, unabhängig von den eingesetzten Mitteln. Ein Mitarbeiter kann hohe Leistung erbringen, aber trotzdem unproduktiv sein, wenn der Ressourceneinsatz unverhältnismäßig hoch ist.
Kann Produktivität in Dienstleistungsunternehmen gemessen werden? Ja, in Dienstleistungsunternehmen wird Produktivität beispielsweise anhand der Anzahl bearbeiteter Kundenanfragen je Zeiteinheit oder Umsatz pro Mitarbeiter gemessen. Auch Durchlaufzeiten von Beratungsprozessen oder die Anzahl abgeschlossener Projekte pro Quartal sind relevante Messgrößen. Weitere Informationen und praktische Tipps finden Sie auch auf unserer FAQ-Seite, die als Self-Service-Seite zusätzliche Hilfestellungen bietet.
Welche Rolle spielt Qualität bei der Produktivitätsmessung? Qualität des Outputs ist von der Mengenproduktivität zu trennen, muss aber parallel überwacht werden. Eine reine Fokussierung auf Mengenproduktivität ohne Qualitätskontrolle kann zu Problemen führen, da Fehler Nacharbeit verursachen und die tatsächliche Effizienz reduzieren.
Wie oft sollte Produktivität gemessen werden? Experten empfehlen, produktivitätsbezogene KPIs regelmäßig - etwa monatlich oder quartalsweise - zu überprüfen, um saisonale Schwankungen und nachhaltige Trends zu erkennen. Die Häufigkeit hängt von der Art des Geschäfts und der Volatilität der Messgrößen ab.
Was sind typische Produktivitätskennzahlen? Häufig verwendete Kennzahlen sind Umsatz pro Mitarbeiter, Stückzahl pro Arbeitsstunde, Durchsatz pro Ressourceneinheit und Anzahl bearbeiteter Vorgänge pro Zeiteinheit. Ergänzend werden Qualitätsindikatoren wie Durchlaufzeit, Ausschussquote und Reklamationsrate herangezogen.
Herausforderungen und Zukunftstrends
Die Messung und Steigerung von Produktivität steht vor neuen Herausforderungen, die durch den Wandel zur Wissensgesellschaft und digitale Transformation entstehen. Dabei gewinnen Daten eine immer größere Bedeutung, da sie als Grundlage für die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen in der Produktivitätsmessung dienen.
Produktivität in der Wissensarbeit
Die produktivitätsbezogene Messung in modernen, wissensintensiven Unternehmen bleibt ein methodisch herausforderndes Feld. Gerade bei Wissensarbeitern existieren keine universell akzeptierten, praxistauglichen Messmethoden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht unterscheidet sich die Betrachtung der Produktivität in der Wissensarbeit deutlich von der klassischen Produktion, da qualitative Faktoren wie Kreativität, Innovationskraft und Kundenfeedback zunehmend integriert werden.
Digitalisierung und KI als Produktivitätstreiber
Der Stellenwert von Digitalisierung und KI in der Produktivitätsentwicklung nimmt kontinuierlich zu. Laut aktuellen Studien sorgen digitale Tools bereits heute in rund 40% der deutschen Unternehmen für nachweisbar höhere Produktivität.
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist dabei die Nutzung von Daten: Durch die Erhebung und Auswertung von Unternehmenskennzahlen und Leistungsdaten können KI und digitale Tools gezielt eingesetzt werden, um Geschäftsprozesse zu optimieren und Effizienzpotenziale zu identifizieren.
Industrie 4.0-Innovationen wie IoT, Smart Factory und Data Analytics treiben diese Entwicklung weiter voran. Prognosen zufolge könnten diese Technologien bis 2030 Produktivitätszuwächse von bis zu 2% jährlich ermöglichen.
Nachhaltigkeit und Produktivität
Ein neuer Fokus liegt auf der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Produktivitätsmessungen. Unternehmen berücksichtigen zunehmend ökologische Faktoren und soziale Auswirkungen in ihren Produktivitätsanalysen. Dabei spielen Daten eine zentrale Rolle, da sie es ermöglichen, sowohl nachhaltigkeitsbezogene als auch wirtschaftliche Kennzahlen systematisch zu erfassen und auszuwerten.


Fazit
Produktivität bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen aller Größen und Branchen. Das Verständnis der verschiedenen Produktivitäten, ihrer Messung und gezielten Steigerung ermöglicht es Führungskräften, fundierte Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Verbesserungen zu implementieren.
Die Kombination aus klaren Definitionen, präzisen Messverfahren und systematischen Optimierungsstrategien schafft die Grundlage für langfristigen Unternehmenserfolg. Während sich die Arbeitswelt durch Digitalisierung und neue Arbeitsformen wandelt, bleiben die Grundprinzipien der Produktivitätsmessung bestehen.
Investitionen in Technologie, Mitarbeiterqualifizierung, Prozessoptimierung und eine strategische KPI-Orientierung bieten den größten Hebel für nachhaltige Steigerungen der Unternehmensproduktivität. Unternehmen, die diese Faktoren systematisch angehen, schaffen sich entscheidende Wettbewerbsvorteile.
Ein regelmäßiger Vergleich der eigenen Produktivitätskennzahlen mit denen der Konkurrenz oder anderer Standorte hilft dabei, Optimierungspotenziale zu erkennen und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.
Beginnen Sie noch heute mit der systematischen Analyse Ihrer Produktivitätskennzahlen und entwickeln Sie eine maßgeschneiderte Strategie für Ihr Unternehmen. Die Zeit für Optimierung ist jetzt - Ihre Konkurrenz arbeitet bereits daran.
Unser Produkt Datenblatt
Die wichtigsten Punkte im Überblick
In der heutigen Geschäftswelt entscheidet die Produktivität maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen. Während 53% der führenden Unternehmen ihre Produktivitätskennzahlen regelmäßig überwachen, kämpfen viele Organisationen noch immer damit, ihre Ressourcen optimal zu nutzen. Die Fähigkeit, das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis zu verstehen und zu optimieren, wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Doch Produktivität spielt nicht nur in Unternehmen, sondern auch im Alltag eine wichtige Rolle, da sie unsere täglichen Routinen und Handlungen beeinflusst.
Produktivität ist weit mehr als nur eine einfache Kennzahl - sie bildet das Fundament für nachhaltiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Der Begriff Produktivität bezeichnet im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen Input und Output beschreibt und sich von verwandten Begriffen wie Wirtschaftlichkeit und Rentabilität unterscheidet. Von der Arbeitsproduktivität einzelner Mitarbeiter bis hin zur totalen Faktorproduktivität ganzer Volkswirtschaften: Das Verständnis verschiedener Produktivitäten und ihrer Messung ermöglicht es Führungskräften, gezielte Verbesserungen zu implementieren.
In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie alles Wichtige über Produktivität: von den grundlegenden Definitionen und Berechnungsformeln über die verschiedenen Arten bis hin zu bewährten Strategien zur Produktivitätssteigerung. Wir zeigen Ihnen praxisnahe Beispiele und geben Ihnen das Rüstzeug an die Hand, um Produktivität in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu messen und zu optimieren.
Was ist Produktivität? - Definition und Grundlagen
Produktivität bezeichnet eine zentrale betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem erzielten Produktionsergebnis (Output) und den eingesetzten Produktionsfaktoren (Input) beschreibt. Bei der Produktivitätsmessung spielt die Arbeitszeit als Ressource eine wichtige Rolle, da sie direkt mit der Arbeitsproduktivität und der Effizienz der Arbeitsleistung verknüpft ist. Diese Definition aus der Betriebswirtschaftslehre bildet die Grundlage für das Verständnis wirtschaftlicher Effizienz in Unternehmen und der Volkswirtschaftslehre.
Die Produktivität misst, wie effizient ein Unternehmen, ein Team oder eine Person eingesetzte Ressourcen in Ergebnisse oder Produkte umsetzt. Arbeit ist dabei einer der wichtigsten Produktionsfaktoren, dessen Optimierung – etwa durch Schulungen, Anpassung der Arbeitszeit oder technologische Verbesserungen – die Produktivität maßgeblich steigern kann. Der Ausstoß, also die produzierte Menge an Gütern oder Dienstleistungen, wird durch den gezielten Einsatz verschiedener Produktionsfaktoren beeinflusst. Die betriebswirtschaftliche Sicht auf die Produktivität umfasst die Analyse und Optimierung betriebsinterner Abläufe, wobei Daten zur Erhebung und Auswertung von Leistungskennzahlen eine zentrale Rolle spielen. Die Einsatzmengen der Produktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital oder Boden bestimmen maßgeblich die Produktivität, da sie den Input für den Produktionsprozess liefern. Die Rolle des Faktors Arbeit, Kapital oder Boden wird bei der Produktivitätsmessung durch das Verhältnis von Output zu Input-Menge deutlich. Die Menge der eingesetzten Ressourcen und die produzierte Output-Menge sind entscheidend für die Berechnung und Bewertung der Produktivität. Der Produktionsvorgang beschreibt dabei die Umwandlung von Input in Output und steht im Zentrum der Produktivitätsanalyse. Verschiedene betriebswirtschaftliche Sichten und Perspektiven ermöglichen eine differenzierte Betrachtung der Produktivität und ihrer Einflussfaktoren. Der Vergleich von Produktivitätskennzahlen dient dem Benchmarking und der Identifikation von Optimierungspotenzialen.
Ein entscheidender Unterschied liegt in der Abgrenzung zur Wirtschaftlichkeit: Während Produktivität das Mengenverhältnis zwischen Input und Output fokussiert, bezieht sich Wirtschaftlichkeit auf das Wertverhältnis von Ertrag zu Kosten. Diese Unterscheidung ist in der Praxis von großer Bedeutung, da sie verschiedene Perspektiven der Unternehmensanalyse ermöglicht.
Produktivität ist sowohl im produzierenden Gewerbe als auch bei Dienstleistungen relevant. Sie dient als Grundlage, um Prozesse und Ressourcennutzung zu bewerten, Engpässe zu identifizieren und gezielte Optimierungen vorzunehmen. In allen Bereichen der Wirtschaft ermöglicht die Produktivitätsmessung eine objektive Bewertung der Leistungsfähigkeit. In der Volkswirtschaft beschreibt die Produktivität die Leistungsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften und ist ein zentrales Kriterium für die Analyse nationaler Wirtschaftssysteme. Die Produktivität ist somit ein wesentlicher Faktor für die volkswirtschaftliche Entwicklung und das Wirtschaftswachstum.
Produktivität berechnen: Formeln und Beispiele
Die Berechnung der Produktivität folgt einer klaren, standardisierten Formel, die in verschiedenen Kontexten angewendet werden kann. Die Aussagekraft von Produktivitätskennzahlen liegt darin, dass sie für Vergleiche und Analysen zwischen Unternehmen oder Zeiträumen herangezogen werden können. Der Kapitaleinsatz stellt dabei eine wichtige Inputgröße dar, die bei der Produktivitätsberechnung berücksichtigt wird. Lässt sich die Produktivität durch verschiedene Methoden und Kennzahlen messen, können gezielt Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Der Arbeitseinsatz, gemessen als Menge an geleisteten Arbeitsstunden, ist ein zentraler Faktor im Produktionsprozess zur Messung der Produktivität. Die Größe der Input- und Outputmengen ist eine wesentliche Messgröße bei der Bewertung der Produktivität. Güter, also die produzierten Waren oder Dienstleistungen, stellen den Output dar, der in Relation zu den eingesetzten Ressourcen bewertet wird. Die Maschinenproduktivität dient als Kennzahl, um die Effizienz von Maschinen im Produktionsprozess zu bestimmen.
Die Grundformel lautet:
Produktivität = Ausbringungsmenge (Output) / Einsatzmenge (Input)
Diese Formel bildet das Fundament für alle weiteren Produktivitätsanalysen und ermöglicht eine quantifizierbare Bewertung der Effizienz.
Praktisches Beispiel aus der Produktion
Ein konkretes Beispiel verdeutlicht die Anwendung: Werden in einer Woche 56.000 Metallteile mit einem Ressourceneinsatz von 10.000 Arbeitsstunden gefertigt, beträgt die Arbeitsproduktivität 5,6 Stück pro Arbeitsstunde. Der Ausstoß, also die produzierte Menge an Metallteilen, liegt in diesem Fall bei 56.000 Stück. Die Einsatzmengen, wie hier die 10.000 Arbeitsstunden, stellen die Inputgröße im Produktionsprozess dar. Die Output-Menge von 56.000 Metallteilen dient als Kennzahl, um die Produktivität und Effizienz der eingesetzten Ressourcen zu messen. Diese Kennzahl ermöglicht sowohl Vergleiche zwischen verschiedenen Produktionslinien als auch die Bewertung von Verbesserungsmaßnahmen.
Herausforderungen bei der Messung
Bei der praktischen Anwendung ergeben sich verschiedene Herausforderungen. Unterschiedliche Outputs, wie beispielsweise Schrauben versus komplexe Maschinen, müssen zur Vergleichbarkeit mit Marktpreisen oder Herstellkosten gewichtet werden. Für eine fundierte Analyse und Vergleichbarkeit der Produktivität ist die Erhebung und Auswertung relevanter Daten, wie Unternehmenskennzahlen oder Leistungsdaten, unerlässlich. Input und Output lassen sich sowohl als Stromgrößen (pro Zeiteinheit) als auch als Bestandsgrößen messen.
Besonders bei längerfristigen Vergleichen wird eine Preisbereinigung notwendig, um Inflationseffekte auszuschließen und aussagekräftige Produktivitätsvergleiche zu ermöglichen. In der Software-Entwicklung kommen spezialisierte Methoden wie NESMA Funktionspunkte oder COSMIC zum Einsatz, um standardisierte Produktivitätsmetriken zu schaffen.

Arten der Produktivität
Die verschiedenen Arten der Produktivität ermöglichen differenzierte Analysen und spezifische Optimierungsansätze, wobei die Rolle des jeweiligen Faktors bei der Produktivitätsmessung besonders im Fokus steht. Je nach Betrachtungsweise und Zielsetzung kommen unterschiedliche Messverfahren zum Einsatz.
Partielle Faktorproduktivität
Die partielle Faktorproduktivität misst das Verhältnis des Outputs zu einem einzelnen eingesetzten Produktionsfaktor. Diese Art der Messung ermöglicht gezielte Analysen einzelner Ressourcen und deren Effizienz.
Arbeitsproduktivität stellt die bekannteste und wichtigste Form dar. Sie misst den Output pro Arbeitseinheit und wird häufig als Bruttoinlandsprodukt pro geleistete Arbeitsstunde ausgedrückt. In Unternehmen zeigt sich die Arbeitsproduktivität beispielsweise in der Anzahl bearbeiteter Kundenanfragen pro Mitarbeiter oder produzierten Stückzahlen pro Arbeitsstunde.
Kapitalproduktivität erfasst den Output pro eingesetzte Kapitaleinheit, gemessen in Maschinenstunden oder investiertem Kapital. Bei der Messung der Kapitalproduktivität wird der Kapitaleinsatz als Inputgröße betrachtet, um die Effizienz des eingesetzten Kapitals im Verhältnis zum erzielten Output zu bewerten. Diese Kennzahl ist besonders relevant für Investitionsentscheidungen und die Bewertung des Kapitaleinsatzes.
Materialproduktivität beschreibt das Verhältnis von Output zu Materialverbrauch und ist in der Industrie entscheidend für die Ressourceneffizienz. Eine hohe Materialproduktivität bedeutet weniger Verschwendung und geringere Produktionskosten.
Bodenproduktivität findet insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft Anwendung und misst den Ertrag pro Hektar. Diese spezielle Art der Produktivitätsmessung berücksichtigt die Besonderheiten natürlicher Ressourcen.
Totale Faktorproduktivität (TFP)
Die totale Faktorproduktivität betrachtet das Zusammenwirken aller Produktionsfaktoren gleichzeitig. Die Formel lautet:
TFP = Output / Summe aller Input-Faktoren
Dabei werden die Einsatzmengen der verschiedenen Produktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital und Boden berücksichtigt, um die Produktivität des gesamten Produktionsprozesses zu messen.
Diese umfassende Betrachtung ist ein Schlüsselindikator für technischen Fortschritt, Innovationen und Organisationsverbesserungen. Die Total Factor Productivity erklärt den Anstieg der Outputmenge, der nicht durch die reine Erhöhung einzelner Inputs erklärbar ist. In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird sie als technologischer Fortschritt oder als der unerklärbare Rest im Outputwachstum interpretiert.
Grenzproduktivität
Die Grenzproduktivität bezeichnet den zusätzlichen Output, der durch den Einsatz einer weiteren Einheit eines Produktionsfaktors entsteht, während alle anderen Inputs konstant bleiben. Die Größe der Outputveränderung bei Variation des Inputfaktors dient dabei als Maß für die Grenzproduktivität. Sie ist mathematisch als partielle Ableitung der Produktionsfunktion bestimmbar und ist unter realen Bedingungen meist abnehmend nach dem Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag.
Grenzproduktivitäten bestimmen in vollständigen Wettbewerbsmodellen die Faktorpreise und sind daher von großer theoretischer und praktischer Bedeutung für Unternehmen und Märkte.
Produktivität vs. verwandte Begriffe
Das Verständnis der Unterschiede zwischen Produktivität und verwandten Begriffen ist essentiell für eine präzise Unternehmensanalyse und zielgerichtete Optimierungsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu steht das Gegenteil von Produktivität, nämlich Unproduktivität, die durch ineffiziente oder destruktive Maßnahmen gekennzeichnet ist und die Zielerreichung im Unternehmen behindert.
Produktivität vs. Effizienz
Während Produktivität das Mengenverhältnis von Output zu Input abbildet, steht Effizienz für die Fähigkeit, einen Output mit möglichst geringem Input zu erreichen. Effizienz kann sowohl maximalen Output bei festem Input als auch minimalen Input bei festem Output bedeuten.
Je nach Sicht kann die Analyse von Produktivität und Effizienz unterschiedliche Schwerpunkte setzen, etwa im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Zielsetzungen oder Vergleichbarkeit.
Der zentrale Unterschied liegt im Fokus: Produktivität zielt auf mehr Output bei gleichbleibendem Input, während Effizienz gleichen Output bei reduziertem Input anstrebt. Beide Konzepte zielen auf optimalen Ressourceneinsatz, jedoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Produktivität vs. Wirtschaftlichkeit vs. Rentabilität
Diese drei Begriffe unterscheiden sich fundamental in ihrer Betrachtungsweise:
- Produktivität: Mengenverhältnis Output/Input
- Wirtschaftlichkeit: Wertverhältnis Ertrag/Kosten
- Rentabilität: Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital
Ein Vergleich dieser Kennzahlen ist für die betriebswirtschaftliche Analyse unerlässlich, da er ermöglicht, die Leistung und Effizienz verschiedener Unternehmen, Abteilungen oder Standorte systematisch zu bewerten und Optimierungspotenziale zu identifizieren.
Während Produktivität ausschließlich Mengen betrachtet, bezieht Wirtschaftlichkeit finanzielle Aspekte mit ein. Rentabilität stellt schließlich den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital und ist damit eine Kennzahl für die Kapitalrendite.
Produktivität messen im Unternehmen
Die praktische Messung von Produktivität in Unternehmen erfordert einen systematischen Ansatz und die Auswahl geeigneter Kennzahlen. Verschiedene Indikatoren ermöglichen eine spezifische Bewertung von Abteilungen, Prozessen und Mitarbeitern.
Auswahl relevanter Kennzahlen
Typische Produktivitätskennzahlen umfassen:
- Umsatz pro Mitarbeiter (häufig für Kosten-Nutzen-Betrachtungen genutzt)
- Stückzahl pro Arbeitsstunde (klassische Produktionskennzahl)
- Durchsatz pro Ressourceneinheit
- Anzahl bearbeiteter Vorgänge pro Zeiteinheit (vor allem in Dienstleistung und Verwaltung)
- Durchlaufzeit, Ausschussquote, Reklamationsrate als ergänzende Größen zur Qualitätskontrolle
Die Output-Menge ist dabei eine zentrale Kennzahl, um die Effizienz einzelner Produktionsfaktoren zu bewerten und das Verhältnis von produziertem Output zur eingesetzten Input-Menge zu bestimmen.
Übersicht der Messverfahren
Da eine Gesamtproduktivität schwer bestimmbar ist, fokussieren Unternehmen oft auf Teilproduktivitäten. Diese ermöglichen gezielte Verbesserungen in spezifischen Bereichen und schaffen Transparenz über Leistungsunterschiede.
Für Benchmark-Vergleiche und die Bewertung der Produktivität spielen erhobene und ausgewertete Daten eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für fundierte betriebliche Analysen und Vergleiche bilden.
Benchmark-Vergleiche mit Vorperioden oder Branchenwerten sind essentiell für die Bewertung der Leistungsentwicklung. Die Produktivitätsveränderung wird quantifiziert als:
Produktivitätsveränderung = (Produktivität - Produktivität_Benchmark) / Produktivität_Benchmark
Regelmäßige Messung und Trends
Die regelmäßige Messung - monatlich oder quartalsweise - ermöglicht es, Trends und Optimierungsmöglichkeiten frühzeitig zu identifizieren. Die kontinuierliche Erhebung und Auswertung relevanter Daten ist dabei entscheidend, um Produktivitätstrends im Unternehmen zuverlässig zu erkennen. Experten empfehlen, produktivitätsbezogene KPIs in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um saisonale Schwankungen und nachhaltige Trends zu erkennen.
Prozessoptimierung als Hebel für Produktivität
Prozessoptimierung zählt zu den wirkungsvollsten Hebeln, um die Produktivität im Unternehmen nachhaltig zu steigern. Durch eine gezielte Analyse bestehender Prozesse lassen sich Schwachstellen und Ineffizienzen identifizieren, die den optimalen Einsatz von Ressourcen behindern. Unternehmen, die ihre Abläufe regelmäßig überprüfen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung umsetzen, können nicht nur ihre Produktionsergebnisse erhöhen, sondern auch Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Im Zentrum der Prozessoptimierung steht das Ziel, den Ressourceneinsatz zu minimieren und gleichzeitig den Output zu maximieren. Dies gelingt, indem Unternehmen ihre Arbeitsabläufe systematisch hinterfragen, Engpässe beseitigen und innovative Lösungen implementieren. Die kontinuierliche Optimierung von Prozessen ist somit ein entscheidender Faktor, um die Produktivität zu steigern und den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern.
Methoden der Prozessoptimierung
Um die Produktivität und Effizienz im Unternehmen gezielt zu steigern, stehen verschiedene bewährte Methoden der Prozessoptimierung zur Verfügung:
- Lean-Management: Dieser Ansatz fokussiert sich auf die konsequente Beseitigung von Verschwendung in allen Unternehmensbereichen. Durch die Optimierung von Prozessen und die Reduzierung nicht-wertschöpfender Tätigkeiten wird die Produktivität gesteigert und die Effizienz erhöht.
- Six Sigma: Mit Six Sigma steht Unternehmen eine strukturierte Methode zur Verfügung, um Fehlerquellen in Prozessen zu identifizieren und nachhaltig zu beseitigen. Ziel ist es, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern und so die Produktivität zu erhöhen.
- Kaizen: Kaizen setzt auf die kontinuierliche, schrittweise Verbesserung von Prozessen und Produkten. Durch kleine, regelmäßige Veränderungen werden Effizienz und Produktivität im Unternehmen langfristig gesteigert.
- Business-Process-Reengineering: Dieser Ansatz geht einen Schritt weiter und setzt auf die grundlegende Neugestaltung von Prozessen. Unternehmen analysieren ihre Abläufe von Grund auf und entwickeln innovative Lösungen, um die Produktivität und Effizienz signifikant zu verbessern.
Der gezielte Einsatz dieser Methoden ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse optimal aufeinander abzustimmen, Ressourcen effizient zu nutzen und die Produktivität nachhaltig zu steigern.
Praxisbeispiele und Erfolgsfaktoren
Zahlreiche Unternehmen haben durch gezielte Prozessoptimierung ihre Produktivität und Effizienz deutlich gesteigert. So hat beispielsweise Toyota mit der Einführung von Lean-Management und Kaizen seine Produktionsprozesse revolutioniert und weltweit Maßstäbe in Sachen Produktivität gesetzt. General Electric konnte durch die Implementierung von Six Sigma die Fehlerquote in der Produktion drastisch senken und die Produktivität erhöhen. Dell wiederum hat mit Business-Process-Reengineering seine Abläufe neu gestaltet und dadurch die Produktivität im gesamten Unternehmen gesteigert.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Prozessoptimierung sind:
- Klare Vision und Strategie: Unternehmen benötigen eine eindeutige Zielsetzung und eine durchdachte Strategie, um alle Beteiligten auf das gemeinsame Ziel der Produktivitätssteigerung auszurichten.
- Umfassende Analyse der Prozesse: Nur durch eine detaillierte Analyse lassen sich Schwachstellen und Potenziale zur Effizienzsteigerung erkennen.
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung: Prozesse müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um dauerhaft produktiv und effizient zu bleiben.
- Gute Kommunikation und Zusammenarbeit: Eine offene Kommunikation und enge Kooperation zwischen allen Abteilungen und Teams ist entscheidend, damit Optimierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können.
Durch die konsequente Anwendung dieser Erfolgsfaktoren können Unternehmen ihre Produktivität gezielt steigern und sich im Wettbewerb nachhaltig behaupten.
Produktivität steigern: Strategien und Maßnahmen
Die Steigerung der Produktivität erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Faktoren und Prinzipien berücksichtigt. Erfolgreiche Optimierung basiert auf systematischen Strategien und gezielten Maßnahmen.
Ökonomische Prinzipien
Drei grundlegende Prinzipien leiten Produktivitätssteigerungen:
Das Minimalprinzip zielt darauf ab, einen fest definierten Output mit minimalem Ressourceneinsatz zu erreichen. Dieses Prinzip eignet sich besonders für Unternehmen mit festgelegten Produktionszielen. Durch die Anwendung des Minimalprinzips lässt sich die Produktivität gezielt steigern, indem unnötige Aufwände vermieden werden.
Beim Maximalprinzip wird mit gegebenem Input der Output maximiert. Diese Herangehensweise bietet sich an, wenn Ressourcen begrenzt, aber die Nachfrage hoch ist.
Das Extremumprinzip kombiniert beide Ansätze und hilft, Zielkonflikte zu lösen. Es ermöglicht flexible Optimierung je nach Marktlage und Unternehmenssituation.
Faktoren der Mitarbeiterproduktivität
Die Produktivität von Mitarbeitern wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die systematisch optimiert werden können:
Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen umfassen die Gestaltung von Arbeitsplätzen hinsichtlich Licht, Lärm und Ergonomie. Studien zeigen, dass optimierte Arbeitsumgebungen die individuelle Leistung um bis zu 15% steigern können.
Motivation und Employee Experience werden durch Anreizsysteme, flexible Arbeitszeiten und eine positive Unternehmenskultur gefördert. Laut Studien aus der Praxis führen Maßnahmen wie Homeoffice-Angebote oder flexible Arbeitszeiten zu Produktivitätssteigerungen von bis zu 13% im internationalen Durchschnitt.
Ein zentraler Aspekt ist die effiziente Nutzung der Arbeitszeit, da eine gezielte Erfassung und Optimierung der Arbeitszeit maßgeblich zur Steigerung der Arbeitsproduktivität beiträgt.
Qualifikation und Weiterbildung stärken die Kompetenz der Mitarbeiter durch kontinuierliche Schulungen und Entwicklungsprogramme. Investitionen in Wissen und Fähigkeiten zahlen sich langfristig durch höhere Arbeitsleistung aus.
Moderne Technologien und Tools unterstützen effizientes Arbeiten durch Automatisierung und digitale Workflows. Investitionen in Automatisierungstechnologien können in der Industrie, je nach Ausgangslage, Effizienzgewinne von bis zu 30% bringen.
Ziele definieren und KPIs festlegen
Erfolgreiche Produktivitätssteigerung beginnt mit klaren Zielsetzungen und messbaren Kennzahlen:
- Zeit bis zur ersten Antwort und Bearbeitungszeit
- Anzahl bearbeiteter Vorgänge pro Zeiteinheit
- Kundenzufriedenheitswerte (CSAT) als Qualitätsindikator
- Regelmäßige Leistungsmessung gemeinsam mit Mitarbeitenden
Die Erhebung und Auswertung relevanter Daten ist dabei entscheidend, um KPIs festzulegen und deren Entwicklung zur Produktivitätssteigerung kontinuierlich zu überwachen.
Diese KPIs ermöglichen eine objektive Bewertung von Verbesserungsmaßnahmen und schaffen Transparenz über den Fortschritt.
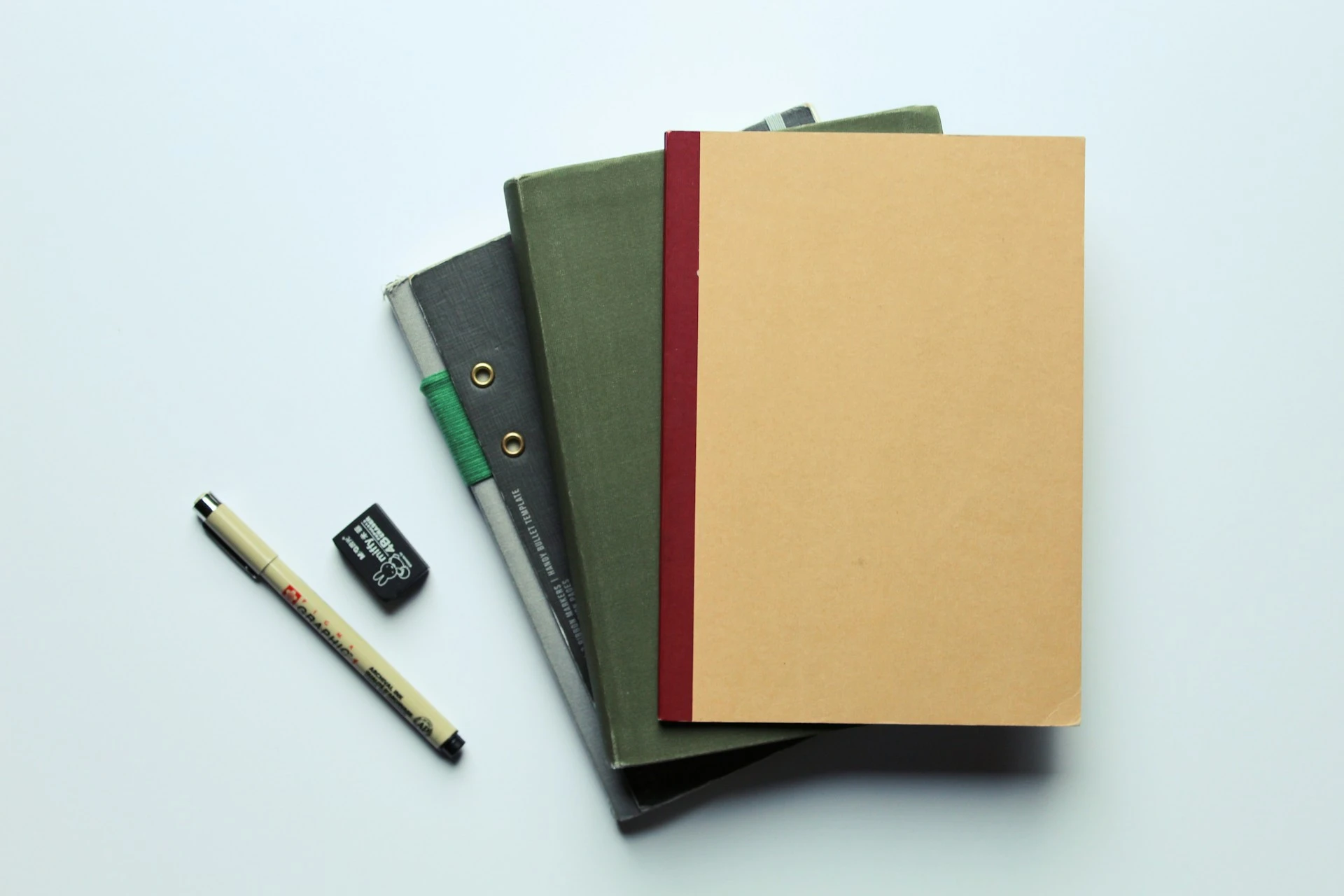
Volkswirtschaftliche Bedeutung der Produktivität
Produktivität spielt eine zentrale Rolle für den wirtschaftlichen Wohlstand und die Entwicklung von Ländern und Regionen, insbesondere im Rahmen der Volkswirtschaft und für das Wachstum ganzer Volkswirtschaften. Die verschiedenen Aspekte der volkswirtschaftlichen Produktivität beeinflussen sowohl einzelne Unternehmen als auch ganze Volkswirtschaften. Die Größe einer Volkswirtschaft ist dabei ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Produktivität, da sie das Ausmaß der eingesetzten Produktionsfaktoren und den Umfang des Outputs bestimmt. Die produzierten Güter stellen den Output der Volkswirtschaft dar und dienen als Maßstab für die Effizienz und Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Einsatz von Ressourcen.
Arbeitsproduktivität als Wohlstandsindikator
Die Arbeitsproduktivität wird als reales BIP pro Arbeitsstunde oder je Erwerbstätigem gemessen und gilt als Schlüsselindikator für den Wohlstand eines Landes. Laut OECD stieg die Arbeitsproduktivität in Deutschland von den 1990er Jahren bis Mitte der 2010er um circa 1,5% jährlich, schwächte sich zuletzt jedoch ab.
Diese Entwicklung spiegelt sich in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wider und beeinflusst die Lebensstandards der Bevölkerung direkt. Länder mit höherer Arbeitsproduktivität können in der Regel höhere Löhne zahlen und bessere soziale Leistungen anbieten.
Kapitalproduktivität und Investitionseffizienz
Sinkende Kapitalproduktivität, ausgelöst etwa durch Überinvestitionen oder ineffiziente Kapitalverwendung, kann die Rendite von Unternehmen oder ganzen Volkswirtschaften gefährden. Der Kapitaleinsatz ist dabei ein entscheidender Faktor für die Bewertung der Kapitalproduktivität in Volkswirtschaften. Dies führt zu Ressourcenumverteilungen und beeinflusst Investitionsentscheidungen maßgeblich.
Standortfaktoren und regionale Entwicklung
Verschiedene Faktoren beeinflussen die Produktivitätsentwicklung von Standorten:
- Infrastruktur und Verkehrsanbindung
- Bildungsniveau und Qualifikation der Arbeitskräfte
- Innovationskraft und Forschungsaktivitäten
- Regulatorische Rahmenbedingungen
- Die Größe eines Standorts, etwa gemessen an der verfügbaren Bodenfläche oder der Produktionsgröße, wirkt sich ebenfalls auf die Produktivitätsentwicklung aus.
Diese Standortfaktoren bestimmen die Attraktivität für Unternehmen und beeinflussen langfristige Wirtschaftsentwicklungen.
Technischer Fortschritt und TFP
TFP-Zuwächse durch Digitalisierung, Automatisierung oder Organisationsinnovationen gelten als wichtigste Treiber nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Ein Beispiel für technische Effizienzsteigerungen im Zuge des technischen Fortschritts ist die Verbesserung der Maschinenproduktivität, also das Verhältnis von Maschinenstunden zur produzierten Menge. Laut World Economic Forum sind bis zu 50% des Wirtschaftswachstums der Industrieländer in den letzten 50 Jahren auf TFP-Steigerungen zurückzuführen.
Praktische Umsetzung im Unternehmen
Die erfolgreiche Implementierung von Produktivitätsverbesserungen erfordert einen strukturierten Ansatz, der verschiedene Bereiche des Unternehmens umfasst.
Schulungen und Entwicklung
Qualifizierungsmaßnahmen bilden das Fundament für nachhaltige Produktivitätssteigerungen:
Gezielte Schulungen tragen wesentlich dazu bei, den Einsatz von Arbeit zu optimieren und die Produktivität im Unternehmen zu steigern.
Gründliches Onboarding für neue Mitarbeitende schafft von Beginn an die Voraussetzungen für effizientes Arbeiten. Strukturierte Einarbeitungsprogramme reduzieren die Zeit bis zur vollen Produktivität erheblich.
Kontinuierliche Weiterbildung zur Kompetenzstärkung hält das Wissen auf dem neuesten Stand und ermöglicht den Umgang mit neuen Technologien und Prozessen.
Bereitstellung von Lernressourcen und Wissensdatenbanken unterstützt selbstständiges Lernen und schnelle Problemlösung. Digitale Plattformen ermöglichen zeit- und ortsunabhängigen Zugang zu relevanten Informationen.
Technologie und Tools
Der intelligente Einsatz von Technologie multipliziert die Produktivität erheblich:
Software-Lösungen zum Task-Management, zur Automatisierung von Routinetätigkeiten und für Analyse- und Controlling-Tools erhöhen die Skalierbarkeit und Effizienz erheblich. Die gezielte Erhebung und Auswertung von Daten spielt dabei eine zentrale Rolle, um die passenden Technologien auszuwählen und deren Nutzen für die Produktivitätssteigerung messbar zu machen.
Automatisierung durch Robotic Process Automation und digitale Workflows kann laufende Prozesse entlasten und Kapazitäten freisetzen. In hochdigitalisierten Unternehmen liegt die durchschnittliche Produktivität regelmäßig 15-25% über dem Wert vergleichbarer Unternehmen ohne Digitalisierung.
Integration verschiedener Systeme für effiziente Workflows eliminiert Medienbrüche und reduziert manuelle Übertragungsfehler. Moderne ERP-Systeme verbinden alle Unternehmensbereiche und schaffen durchgängige Datenflüsse.
Messung und Kontrolle
Kontinuierliches Monitoring und Anpassung sichern den Erfolg von Produktivitätsmaßnahmen:
Die kontinuierliche Erhebung und Auswertung relevanter Daten ist entscheidend, um die Kontrolle und Steuerung von Produktivitätsmaßnahmen zu gewährleisten. Die Messung von Zeit bis zur ersten Reaktion (first response time), Durchlaufzeiten je Prozessschritt und regelmäßige Leistungsmessungen im Dialog mit Mitarbeitenden helfen, Verbesserungspotenziale frühzeitig zu identifizieren.
Qualität des Outputs muss parallel zur Mengenproduktivität überwacht werden. Sinkende Qualität kann zu vermeintlichen Produktivitätssteigerungen führen, die in der Praxis aber zu Nacharbeit und erhöhten Fehlerquoten führen.
FAQ - Häufig gestellte Fragen zur Produktivität
Wie unterscheidet sich Produktivität von Leistung? Produktivität misst das Verhältnis von Output zu Input, während Leistung lediglich das absolute Ergebnis beschreibt, unabhängig von den eingesetzten Mitteln. Ein Mitarbeiter kann hohe Leistung erbringen, aber trotzdem unproduktiv sein, wenn der Ressourceneinsatz unverhältnismäßig hoch ist.
Kann Produktivität in Dienstleistungsunternehmen gemessen werden? Ja, in Dienstleistungsunternehmen wird Produktivität beispielsweise anhand der Anzahl bearbeiteter Kundenanfragen je Zeiteinheit oder Umsatz pro Mitarbeiter gemessen. Auch Durchlaufzeiten von Beratungsprozessen oder die Anzahl abgeschlossener Projekte pro Quartal sind relevante Messgrößen. Weitere Informationen und praktische Tipps finden Sie auch auf unserer FAQ-Seite, die als Self-Service-Seite zusätzliche Hilfestellungen bietet.
Welche Rolle spielt Qualität bei der Produktivitätsmessung? Qualität des Outputs ist von der Mengenproduktivität zu trennen, muss aber parallel überwacht werden. Eine reine Fokussierung auf Mengenproduktivität ohne Qualitätskontrolle kann zu Problemen führen, da Fehler Nacharbeit verursachen und die tatsächliche Effizienz reduzieren.
Wie oft sollte Produktivität gemessen werden? Experten empfehlen, produktivitätsbezogene KPIs regelmäßig - etwa monatlich oder quartalsweise - zu überprüfen, um saisonale Schwankungen und nachhaltige Trends zu erkennen. Die Häufigkeit hängt von der Art des Geschäfts und der Volatilität der Messgrößen ab.
Was sind typische Produktivitätskennzahlen? Häufig verwendete Kennzahlen sind Umsatz pro Mitarbeiter, Stückzahl pro Arbeitsstunde, Durchsatz pro Ressourceneinheit und Anzahl bearbeiteter Vorgänge pro Zeiteinheit. Ergänzend werden Qualitätsindikatoren wie Durchlaufzeit, Ausschussquote und Reklamationsrate herangezogen.
Herausforderungen und Zukunftstrends
Die Messung und Steigerung von Produktivität steht vor neuen Herausforderungen, die durch den Wandel zur Wissensgesellschaft und digitale Transformation entstehen. Dabei gewinnen Daten eine immer größere Bedeutung, da sie als Grundlage für die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen in der Produktivitätsmessung dienen.
Produktivität in der Wissensarbeit
Die produktivitätsbezogene Messung in modernen, wissensintensiven Unternehmen bleibt ein methodisch herausforderndes Feld. Gerade bei Wissensarbeitern existieren keine universell akzeptierten, praxistauglichen Messmethoden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht unterscheidet sich die Betrachtung der Produktivität in der Wissensarbeit deutlich von der klassischen Produktion, da qualitative Faktoren wie Kreativität, Innovationskraft und Kundenfeedback zunehmend integriert werden.
Digitalisierung und KI als Produktivitätstreiber
Der Stellenwert von Digitalisierung und KI in der Produktivitätsentwicklung nimmt kontinuierlich zu. Laut aktuellen Studien sorgen digitale Tools bereits heute in rund 40% der deutschen Unternehmen für nachweisbar höhere Produktivität.
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist dabei die Nutzung von Daten: Durch die Erhebung und Auswertung von Unternehmenskennzahlen und Leistungsdaten können KI und digitale Tools gezielt eingesetzt werden, um Geschäftsprozesse zu optimieren und Effizienzpotenziale zu identifizieren.
Industrie 4.0-Innovationen wie IoT, Smart Factory und Data Analytics treiben diese Entwicklung weiter voran. Prognosen zufolge könnten diese Technologien bis 2030 Produktivitätszuwächse von bis zu 2% jährlich ermöglichen.
Nachhaltigkeit und Produktivität
Ein neuer Fokus liegt auf der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Produktivitätsmessungen. Unternehmen berücksichtigen zunehmend ökologische Faktoren und soziale Auswirkungen in ihren Produktivitätsanalysen. Dabei spielen Daten eine zentrale Rolle, da sie es ermöglichen, sowohl nachhaltigkeitsbezogene als auch wirtschaftliche Kennzahlen systematisch zu erfassen und auszuwerten.


Fazit
Produktivität bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen aller Größen und Branchen. Das Verständnis der verschiedenen Produktivitäten, ihrer Messung und gezielten Steigerung ermöglicht es Führungskräften, fundierte Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Verbesserungen zu implementieren.
Die Kombination aus klaren Definitionen, präzisen Messverfahren und systematischen Optimierungsstrategien schafft die Grundlage für langfristigen Unternehmenserfolg. Während sich die Arbeitswelt durch Digitalisierung und neue Arbeitsformen wandelt, bleiben die Grundprinzipien der Produktivitätsmessung bestehen.
Investitionen in Technologie, Mitarbeiterqualifizierung, Prozessoptimierung und eine strategische KPI-Orientierung bieten den größten Hebel für nachhaltige Steigerungen der Unternehmensproduktivität. Unternehmen, die diese Faktoren systematisch angehen, schaffen sich entscheidende Wettbewerbsvorteile.
Ein regelmäßiger Vergleich der eigenen Produktivitätskennzahlen mit denen der Konkurrenz oder anderer Standorte hilft dabei, Optimierungspotenziale zu erkennen und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.
Beginnen Sie noch heute mit der systematischen Analyse Ihrer Produktivitätskennzahlen und entwickeln Sie eine maßgeschneiderte Strategie für Ihr Unternehmen. Die Zeit für Optimierung ist jetzt - Ihre Konkurrenz arbeitet bereits daran.

.svg)

.svg)
.svg)

.svg)
.svg)
.svg)






